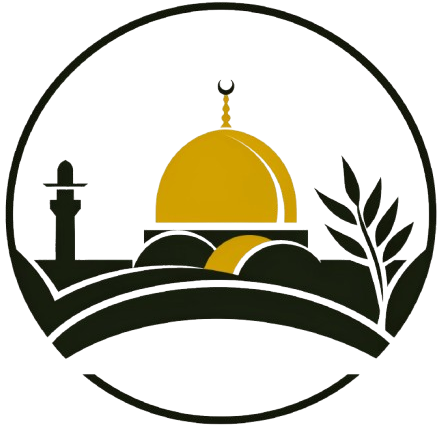Jerusalem
23.2.2024
Tamir holt mich um 9 Uhr ab. Er sagt, es sei eine gute Zeit, um schnell durch den Checkpoint zu kommen. Später lese ich in einem Reiseblog, dass es anscheinend verboten ist, ein Taxi von Israel ins Westjordanland zu nehmen. Man darf mit dem israelischen Taxi nur bis zur Grenze fahren und muss dann in ein lokales Taxi umsteigen. Glücklicherweise wusste ich das zum Zeitpunkt unserer Überquerung nicht. Mir war schon ohne dieses Wissen unwohl bei dem Gedanken an die Checkpoints, auch wenn ich nicht damit rechne, in Schwierigkeiten zu geraten.
Ein deutscher Tourist auf dem Weg nach Bethlehem wirkt unschuldig genug und wird wahrscheinlich durchgewunken. Die Palästinenser sind es, die unter den Checkpoints zu leiden haben. Rashid Khalidi, der ehemalige Professor an der „Columbia“ Universität in New York, beschreibt die Rolle der Checkpoints im Leben der Palästinenser so: „Die Quintessenz der palästinensischen Erfahrung findet an einer Grenze, einem Flughafen, einem Checkpoint statt: kurz gesagt, an einer dieser vielen modernen Barrieren, an denen Identitäten überprüft und verifiziert werden. Für Palästinenser bedeutet die Begegnung mit diesen Barrieren die Erfahrung von Machtlosigkeit und Angst.“
Besonders gefürchtet ist Checkpoint 300, der zwischen Jerusalem und dem südlichen Westjordanland am häufigsten genutzte Checkpoint. Checkpoint 300 bietet ein dystopisches Panorama: Eine neun Meter hohe Betonmauer, Wachtürme mit Fenstern aus verdunkeltem Glas, Maschinengewehrmündungen, die durch Schießspalten lugen, das Ganze geschmückt von Anti-Apartheid-Banksy-Street Art.
Der palästinensische Autor Ahmed Alkhateeb beschrieb 2020 seine Erfahrung mit Checkpoint 300 in einem Artikel für „Haaretz“: „Jeder Raum hat ein käfigartiges Drehkreuz mit einer sehr kleinen Öffnung, durch die nur eine Person passt. Auf der anderen Seite jedes Drehkreuzes befindet sich ein Metalldetektor neben einem kleinen Raum mit einem verdunkelten Glasfenster. Der israelische Soldat im Kontrollraum steuert die Drehkreuze per Fernbedienung.
Eine elektrische Anzeige oben auf dem Drehkreuz leuchtet grün, wenn es offen, und rot, wenn es geschlossen ist. Normalerweise leuchtete sie einige Sekunden lang grün und blieb dann minutenlang rot.“ Die Wartezeit am Checkpoint 300 kann Stunden betragen.⁴¹
Tamir und ich passieren an diesem Morgen den „Tunnels“ Checkpoint. Er erstreckt sich über vier Fahrspuren in Richtung Jerusalem und zwei Fahrspuren in Richtung Bethlehem. Im Gegensatz zu Checkpoint 300 lässt sich „Tunnels“ als „low-tech“ Checkpoint bezeichnen. Außer den Kameras sind keine sichtbaren Maschinen vorhanden – es gibt nicht einmal eine Verkehrsampel, die die Autos davon abhält, auf die Kontrollpunkte zuzufahren.
Die einzigen Mechanismen, die zur Verlangsamung der Autos eingesetzt werden, sind Temposchwellen und die bei der Einreise nach Israel auf der Straße stehenden Soldaten. Meine Nervosität erweist sich als unbegründet; auf der Fahrspur in Richtung Betlehem stehen keine Soldaten, wir werden von dem Uniformierten im Wachhaus anstandslos durchgewunken.
Der „Tunnels“ Checkpoint befindet sich mehrere Kilometer westlich der „Grünen Linie“ im Westjordanland. Die „Grüne Linie“ ist die Waffenstillstandslinie zwischen Israel und dem Westjordanland, dem Gazastreifen, den Golanhöhen und der Sinai-Halbinsel. Im Jahr 1967 wurde sie zur Trennlinie zwischen Israel und den Gebieten, die es im Sechstagekrieg erobert hatte.

Laut Informationen einer NGO existierten im Juni 2020 im gesamten besetzten Westjordanland 179 Checkpoints, sowie 154 Straßentore und 68 Straßensperren. Darüber hinaus errichtet die israelische Armee jedes Jahr Tausende von temporären Checkpoints, so genannte „flying checkpoints“ auf den Straßen im Westjordanland.
Gemäß dem 1995 getroffenen Oslo II-Abkommen zwischen Israel und der PLO wurden die besetzten Gebiete in drei Kategorien unterteilt. „Area A“ ,18 % der Gesamtfläche, stehen unter palästinensischer Autonomieverwaltung (PA). Obwohl die PA die Kontrolle innehat, behält sich Israel das Recht vor, in bestimmten Situationen militärisch einzugreifen. Bethlehem befindet sich in „Area A“. „Area B“, 22 %, sind kleinere Orte unter Kontrolle der israelischen Polizei und des Militärs, die Zivilverwaltung ist palästinensisch. „Area C“, 60 %, unterliegen israelischer Militärverwaltung und Militärrecht. Palästinenser erhalten dort keine Baugenehmigungen.
Das Scheitern von Oslo
Das christliche „Kairos Solidaritätsnetzwerk“ beschreibt die durch die Aufteilung geschaffene Situation auf diese Weise: „Ohne die Gebiete unter israelischer Verwaltung ist ein lebensfähiger Staat Palästina nicht möglich. Die Existenzgrundlage der Palästinenser wird zerstört durch Landraub, die Rodung von mehr als einer Million Oliven- und Aprikosenbäumen und den Entzug der Wasserressourcen: Palästinenser bezahlen für Wasser im Vergleich zu Israelis den dreifachen Preis und erhalten nur 1/5 der Menge, obwohl das Wasser oft aus dem Westjordanland kommt.“⁴²
Die unterschiedliche Wahrnehmung der Verträge von Oslo auf israelischer und palästinensischer Seite ist ein weiteres Beispiel für die bei diesem Thema ständig präsente Gefahr: Sich auf Nebenkriegsschauplätze zu verirren und die entscheidenden Faktoren aus den Augen zu verlieren. Allein über die Oslo Akkorde sind eine ganze Reihe Bücher geschrieben worden.
Beide Seiten sind zutiefst unzufrieden mit dem Ergebnis: Die Israelis, weil die Hamas, die mit dem Abschluss der Verträge nicht einverstanden war, Israel mit einer Welle von Attentaten überzogen hat; die Palästinenser, weil ein eigener souveräner Staat entgegen der Versprechungen in noch weitere Ferne gerückt ist und sie weiter unter der Knute der israelischen Besatzung leben müssen, deren Kontrolle sich in weiten Teilen sogar noch intensiviert hat. Der israelische Historiker Arnon Degani, der sich selbst als Zionist bezeichnet, hat einen interessanten englischsprachigen Podcast zum Thema veröffentlicht.⁴³
Es ist wichtig, sich der fundamentalen Konstellation bewusst zu bleiben: Es geht nicht um einen Konflikt zwischen zwei Parteien, die sich auch nur im Entferntesten auf Augenhöhe befinden. Es geht nicht um Juden und Muslime, die sich schon seit Jahrtausenden da unten gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es geht um Kolonisierung und Widerstand, um Unterdrückung und Selbstbestimmung.
Die US-Regierung schätzt die palästinensische Gesamtbevölkerung des Westjordanlands auf etwa 3 Millionen Menschen. Laut „UNRWA“, dem „Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten“, leben mehr als 912.879 registrierte Flüchtlinge im Westjordanland, etwa ein Viertel davon in 19 Flüchtlingslagern. Die meisten von ihnen sind Nachkommen der Vertriebenen der „Nakba“ von 1948.
Das Desinteresse der Medien
Überbelegung in den Lagern ist die Norm, große Familien leben in engen, stickigen Unterkünften, häufig ohne sanitäre Einrichtungen. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein ständiges Problem, die Stromversorgung ist unregelmäßig und die Abwassersysteme sind unzureichend.
Ein weiteres Problem ist der fehlende Zugang zu Bildung und beruflichen Chancen. Es herrscht Arbeitslosigkeit und Armut, viele Kinder sind unterernährt. Die Situation in Gaza ist noch bedrückender, vor allem seit Beginn der israelischen Blockade im Jahr 2007. Es sind Lebensumstände, die sich viele Deutsche kaum vorstellen können und über die in deutschen Medien kaum berichtet wird.
Das gilt auch für die meisten israelische Medien, mit ein paar löblichen Ausnahmen, wie zum Beispiel den “Haaretz“ Journalisten Amira Hass und Gideon Levy und dem Magazin „+972“. Israel ist unter den Demokratien insofern einzigartig, als das eine ständige Militärzensur existiert. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jeder Artikel über Sicherheitsfragen zuerst bei der Zensur eingereicht werden muss.
Wenn über die Palästinenser in den Lagern berichtet wird, geht es meist um Terroristen und islamische Judenhasser, es gibt kaum persönliche Kontakte zwischen den beiden Gruppen. Viele Israelis setzen das erste Mal den Fuß in das Haus einer palästinensischen Familie in Gaza oder dem Westjordanland, wenn sie als Soldaten während einer nächtlichen Kommandoaktion die Tür eintreten.
Palästinenser im Westjordanland gelten als staatenlos, da sie keine Staatsbürgerschaft in einem anerkannten Staat besitzen. Die PA stellt zwar Personalausweise und Reisepässe aus, diese Dokumente verleihen jedoch keine vollen Staatsbürgerrechte und werden nicht allgemein anerkannt. Israel behält die Kontrolle über das Bevölkerungsregister im Westjordanland, was den rechtlichen Status der Palästinenser weiter verkompliziert.
Die israelischen Behörden schränken die Familienzusammenführung zwischen Palästinensern im Westjordanland und ihren in Israel lebenden Ehepartnerinnen stark ein. Das israelische Staatsangehörigkeitsgesetz verbietet den Familiennachzug von Palästinensern, was bedeutet, dass Palästinenser aus dem Westjordanland, die mit israelischen Staatsbürgern verheiratet sind, keine israelische Staatsbürgerschaft erhalten können.
Staatsbürger erster Klasse
Anfang 2024 lebten etwa 520 000 jüdische Israelis in Siedlungen im Westjordanland. Die Siedler sind israelische Staatsbürger erster Klasse und genießen alle damit einhergehenden Privilegien. Da die Palästinenser im Westjordanland keine anerkannte Staatsbürgerschaft besitzen, genießen sie nur wenig rechtlichen Schutz. Sie unterliegen Militärverordnungen und Gesetzen, die sich erheblich von denen unterscheiden, die für die Siedler gelten. ⁴⁴
Der kontinuierliche Ausbau der Siedlungen hat die Schaffung eines zusammenhängenden palästinensischen Staates unmöglich gemacht. Auch wenn deutsche Politiker, wie z.B. Außenministerin Baerbock immer noch davon sprechen, dass „die Zweistaatenlösung die einzige Lösung“ sei, konstatieren Kenner der Situation wie Illan Pappé und Rashid Khalidi einhellig, dass es keine Möglichkeit mehr für die Umsetzung einer Zweistaatenlösung gibt, selbst wenn in Israel eine Regierung an die Macht kommen sollte, die im Gegensatz zum „Likud“ tatsächlich daran interessiert wäre.
Nach über 50 Jahren Besatzung hat sich im Westjordanland eine komplexe Besatzungsarchitektur entwickelt, deren Ziel es ist, die Anwesenheit der im Westjordanland lebenden Palästinenser vom Alltag der jüdischen Siedler zu separieren. Nichts macht das deutlicher als die Trennmauer, die von Israel errichtet wurde. Die Trennmauer besteht aus Beton, stacheldrahtgesäumten Zäunen und Überwachungstürmen.
Die über 700 Kilometer lange Mauer steht oft weit entfernt von der Grünen Linie, tief in palästinensischem Land. Offiziell dient sie der Sicherheit und soll Angriffe zu verhindern. Doch ihr Verlauf hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben der palästinensischen Bevölkerung; die Mauer zertrennt nicht nur geografische, sondern auch menschliche Verbindungen. Die Sperranlage trennt Städte und Dörfer, zerteilt Plantagen und erschwert den Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung für viele Palästinenser.
Verbotene Straßen
Auch viele der Straßen, die der israelische Staat seit Beginn der Besatzung im Westjordanland gebaut oder erneuert hat, sind allein israelischen Siedlern vorbehalten. Das System ist derart komplex und verwirrend, dass der 2004 erschienene Bericht „Verbotene Straßen“ der israelischen Menschenrechtsorganisation „B’Tselem“ über 50 Seiten umfasst. ⁴⁵
Laut des Berichts weist das „Regime der verbotenen Straßen“, das auf dem Prinzip der Trennung durch Diskriminierung basiert, auffallende Ähnlichkeiten mit dem rassistischen Apartheidregime auf, das bis 1994 in Südafrika existierte. In dem von Israel betriebenen Straßenregime basiert das Recht einer Person, sich im Westjordanland fortzubewegen, auf ihrer nationalen Identität.
Der israelische Staat begründet die Errichtung des Regimes der verbotenen Straßen mit dem Schutz der israelischen Zivilbevölkerung. Während der zweiten „Intifada“, des letzten großen bewaffneten Aufstands der Palästinenser aus den besetzten Gebieten vor dem siebten Oktober 2023, wurden laut „B’Tselem innerhalb von 10 Jahren 741 israelischen Zivilisten getötet, darunter 124 Minderjährige.
Obwohl „B’Tselem“ sich ausdrücklich für das Recht Israels ausspricht, seine Zivilbevölkerung zu schützen, kommt der Bericht im Bezug auf das Regime der verbotenen Straßen zu einem eindeutigen Urteil: „Das Regime der verbotenen Straßen basiert auf der Prämisse, dass alle Palästinenser ein Sicherheitsrisiko darstellen und es daher gerechtfertigt ist, ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dies ist eine rassistische Prämisse, die zu einer Politik geführt hat, die unterschiedslos der gesamten palästinensischen Bevölkerung schadet und ihre Menschenrechte sowie das Völkerrecht verletzt.“
Die Lager von Bethlehem
In der Gegend von Bethlehem befinden sich drei Flüchtlingslager. Das 1949 gegründete „Dheisheh“ Lager beherbergt über 8.800 Einwohner auf einer Fläche von 1,5 Quadratkilometern. „Aida Camp“ wurde 1950 errichtet und hat etwa 2.800 Einwohner. Das Lager „Beit Jibrin“ ist Teil der Gemeinde von Bethlehem und ist das kleinste Flüchtlingslager im Westjordanland. Es ist auch eines der am dichtesten besiedelten Lager. Das Lager hat eine Hauptstraße, die etwa 250 Meter lang ist und durch das gesamte Lager führt.
Die Kinder der Lager „Beit Jibrin“ und „Aida“ besuchen dieselben Schulen, die koedukative Schule in der Stadt Beit Jala und die Jungenschule im Lager „Aida“. Um zur „Aida Boys‘ School“ zu gelangen, müssen die Schüler eine Hauptstraße in der Nähe der Mauer und eines israelischen Wachturms überqueren. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Zusammenstößen, und laut eines UNRWA Berichts werden immer wieder Tränengaskanister und Kugeln auf dem Schulhof gefunden.⁴⁶
Auf dem Weg nach Betlehem weist Tamir mich auf eins der gelben Straßentore aus Metall hin, mit denen die israelische Armee den Zugang zu Städten und Dörfern nach Belieben abriegeln kann. „They block the streets whenever they want“, sagt er. „The Israelis are in control, not the PA.“ Seine lapidare Bemerkung spiegelt die Beschreibung wieder, die Rashid Khalidi von der Situation gibt: „Die PA hat keine Souveränität, keine Gerichtsbarkeit und keine Autorität, außer der, die ihr von Israel zugestanden wird. Israel kontrolliert sogar einen Großteil der Einnahmen in Form von Zöllen und einigen Steuern.
Die Hauptaufgabe der PA, für die ein Großteil ihres Budgets aufgewendet wird, ist die Bewahrung der Sicherheit, aber nicht die des palästinensischen Volkes: Die PA ist von den USA und Israel beauftragt, die Sicherheit für Israels Siedler und Besatzungstruppen gegen den Widerstand, gewalttätig und anderweitig, zu gewährleisten.
Seit 1967 gibt es im gesamten Gebiet des Mandatsgebiets Palästina nur eine staatliche Autorität: die Israels. Die Gründung der PA hat an dieser Realität nichts geändert, sondern nur die Liegestühle auf dem Deck der palästinensischen Titanic neu geordnet und der israelischen Kolonisierung und Besatzung einen unverzichtbaren palästinensischen Schutzschild verschafft.“⁴⁷
Ich würde gerne viele Fragen stellen, über das immer grausamere Vorgehen der Siedler nach dem siebten Oktober und die verbotenen Straßen zum Beispiel, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Der Gazastreifen ist nur 73 Kilometer von Bethlehem entfernt. Die Luftangriffe auf Gaza gehen weiter, komplette Häuserblocks werden dem Erdboden gleichgemacht, jeden Tag werden ganze Familien ausgelöscht, selbst Zeltlager werden beschossen.
Es mangelt nicht an Informationen
Es herrscht Hunger, es gibt kaum Trinkwasser, kaum Medikamente, kaum Strom. In Anbetracht des monströsen Verbrechens, das gerade nicht einmal 100 Kilometer entfernt von uns geschieht, erscheint mir meine Recherche geschmacklos, wie der alberne Versuch an der Illusion festzuhalten, dass es etwas brächte, zu berichten. Es mangelt nicht an Informationen; es mangelt an dem Willen der Mächtigen, etwas zu tun.
Es ist offensichtlich, dass ich nicht der Erste bin, den Tamir auf einer Recherchereise durch Ostjerusalem und das Westjordanland kutschiert. Er erzählt mir schon ungefragt, was auch die anderen wissen wollten. Sein Tonfall ist nicht unfreundlich, aber matt und melancholisch. Ich kann ihn verstehen. Er will die Hoffnung nicht aufgeben, aber es haben schon Generationen von Journalisten über die Situation der Palästinenser berichtet, die Berichte der Menschenrechtsorganisationen und der Vereinten Nationen sind eindeutig und belaufen sich auf tausende von Seiten.
2021 sagte UN Generalsekretär António Guterres: „Wenn es eine Hölle auf Erden gibt, dann ist es das Leben der Kinder in Gaza“. Er drückte damit seine „tiefe Bestürzung“ über die damaligen Luft- und Artillerieangriffe der israelischen Streitkräfte in Gaza aus, die zu diesem Zeitpunkt mehr als 200 Palästinenser, darunter 60 Kinder, das Leben gekostet und Tausende weitere verletzt hatten.⁴⁸
Dem damaligen israelische Premier Naftali Bennett war Guterres Bestürzung gleichgültig, so wie heute das Entsetzen der Welt Benjamin Netanjahu gleichgültig ist.
„Refugeeland“
Ich denke an eine Formulierung des amerikanischen Journalisten Joe Sacco, der seine Zeit in den besetzten Gebieten Anfang der 90er Jahre in einer Art dokumentarischen „Graphic Novel“ verarbeitet hat. „Refugeeland“. Das war der Titel, den Sacco dem Bericht über seinen ersten Besuch eines Flüchtlingslagers im Gazastreifen gegeben hat.
Zum damaligen Zeitpunkt war der Gazastreifen noch nicht komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Diese Phase, die fast die Hälfte der Bevölkerung arbeitslos machte und dazu führte, dass 80% der über 2 Millionen Menschen abhängig von Hilfslieferungen wurden, begann 2007 mit dem Wahlsieg der Hamas.
Sacco schreibt in dem coolen, ironischen Stil, der in den 90er Jahren so beliebt war: „Einige der schwärzesten Löcher der Welt befinden sich unter freiem Himmel und jeder kann sie sehen. Du kannst zum Beispiel eine Tour durch ein palästinensisches Flüchtlingslager im Gazastreifen buchen. Du rufst einfach bei UNRWA, der „United Nations Relief and Works Agency“ an, unter 051-861195. Sie kümmern sich darum, sie fahren Dich, der Eintritt ist frei. Sie werden Dich wahrscheinlich in eine Gruppe mit Schweden und Japanern stecken wollen, aber Du willst, dass Deine Flüchtlingslagererfahrung intimer ist und bestehst darauf, die Tour allein zu machen.“
„Refugeeland“. Eine Formulierung, die 30 Jahre später unpassend wirkt, obwohl Sacco die Absurdität eines Ausflugs in ein Flüchtlingslager verspottet und seine Schilderung der Situation die Humanität der Palästinenser würdigt. Ironie impliziert Distanz und 2024 fällt es schwer, das Grauen auf Distanz halten. 2024 kann die ganze Welt die Bilder des Gemetzels auf dem Handy sehen und wer sich noch nicht dazu entschieden hat, alles Negative auszublenden und sich in eine „Positive-Vibes-Only-Traumwelt“ zurückzuziehen, ist verdammt zu einem Gefühl von Machtlosigkeit, von impotentem moralischem Ekel.
Wounded Child No Surviving Family
Krankenhäuser in Gaza waren gezwungen eine neue Abkürzung einzuführen: „WCNSF“, -Wounded Child No Surviving Family-. Verletzte Kinder werden auf Grund der Blockade ohne Betäubungsmittel operiert, streunende Hunde reißen Stücke aus unbeerdigten Leichen, der Gestank von unbehandeltem Abwasser und unter den Trümmern verwesenden Leichen hängt in der Luft. Aus „Refugeeland“ ist „Genocideland “ geworden und die ironieverliebten 90er wirken wie eine bessere, eine unschuldigere Zeit. 2024 ist ein Jahr, bei dem Schulkinder fragen werden: „Und warum hat damals niemand etwas getan?“, wenn sie es im Geschichtsunterricht durchnehmen.
Wir kommen in Bethlehem an, parken in der Nähe einer Polizeiwache der PA und gehen über den „Manger-Square“ in Richtung der Geburtskirche. Die Straßen der Altstadt rund um die Geburtskirche sind eng und uneben. Die niedrigen Steingebäude mit den bogenförmigen Türen und den vergitterten Fenstern stehen dicht nebeneinander, aber der „Manger-Square“, der Krippenplatz, ist ein weitläufiger, mit hellem Kalkstein gepflasterter Platz.
Christen in Palästina
Auf der westlichen Seite steht die Omar-Moschee, die einzige Moschee der Altstadt. Gegenüber, auf der östlichen Seite, thront die Geburtskirche, stoische Zeugin einer langen und bewegten Geschichte. Die Morgensonne scheint und die wuchtigen Kalksteinmauern der Kirche strahlen in warmen Erdtönen. Der schlichte Glockenturm erhebt sich wie ein Zeigefinger in den Himmel. Es ist ein massives, schroffes Bauwerk, eine festungsähnliche Basilika.
Sie hat Invasionen, Regimewechsel, Brände, Erdbeben und zuletzt die Belagerung durch israelische Truppen im Jahr 2002 überstanden. Im Jahr 1852 wurde die Kirche unter die gemeinsame Obhut der römisch-katholischen, armenischen und griechisch-orthodoxen Kirche gestellt.
Die Basilika ist von drei Klöstern umgeben, die jeweils eine dieser Glaubensrichtungen repräsentieren: das Franziskanerkloster und die Kirche St. Katharina auf der Nordostseite, das armenische Kloster und das griechisch-orthodoxe Kloster auf der Südostseite.
Wir betreten die Kirche durch die „Demutspforte“, einen kleinen rechteckigen Eingang aus osmanischer Zeit. Die Türöffnung wurde verkleinert, um zu verhindern, dass Plünderer zu Pferd eindringen und die Kirche ausrauben. Das Betreten des breiten Kirchenschiffs versetzt einen um fünfzehn Jahrhunderte in der Zeit zurück, besonders an diesem Morgen, denn die ersten fünf Minuten sind wir die einzigen Besucher. Das Kirchenschiff wird von vier Reihen Säulen aus rosa Kalkstein getragen, viele Säulen sind mit Malereien verziert, was genau dargestellt wird, ist im Dämmerlicht schwer zu erkennen.
Auch wenn ich Bethlehem als Besuchsziel im Westjordanland vor allem ausgewählt habe, weil es mir harmlos und unverfänglich erschien, kann ich mich der ehrfurchteinflößenden Wirkung des Kirchenschiffs nicht entziehen. Ich wehre mich innerlich dagegen, denn die ehrfurchteinflößende Architektur sakraler Bauten ist auch eine Form von Einschüchterung, von Manipulation. Sie nutzt das menschliche Bedürfnis nach Selbstverlust und Transzendenz zu Gunsten einer Institution und Institutionen sind dämonisch, wie der Theologe Paul Tillich schreibt.
Gläubige, die mit blutenden Händen beten
Alle religiösen Institutionen sind suspekt, aber die monotheistischen sind die gefährlichsten. Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott: „Du sollst keine Götter neben mir haben“ ist sein erstes Gebot. Monotheismen sind das Substrat, auf dem die Illusion einer Zweiteilung der Menschen in die Guten und die Bösen am besten gedeiht; die Illusion auf der Seite des absolut Guten gegen das absolut Böse zu kämpfen ist die vielleicht wirkungsvollste Rechtfertigung für Krieg und Gewalt.
Trotzdem finden sich in allen heiligen Büchern schöne, ethisch hochstehende Passagen, so zum Beispiel im Koran: „O Menschheit! Wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der Edelste von euch ist vor Gott derjenige, der am gerechtesten ist.“
Im Judentum ist es Tradition am Sabbat und an Feiertagen aus der „Haftarah“, dem Buch Jesaja zu lesen: „Wenn ihr eure Hände ausbreitet, / verhülle ich meine Augen vor euch. Wenn ihr auch noch so viel betet, / ich höre es nicht. / Eure Hände sind voller Blut. Wascht euch, reinigt euch! / Lasst ab von eurem üblen Treiben! / Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun! Lernt, Gutes zu tun! / Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! / Verschafft den Waisen Recht, / tretet ein für die Witwen!“
Widerwärtig sind die Gläubigen, die mit blutigen Händen beten, die sich auf das Ästhetische und Formelle der Religion konzentrieren, den ethischen Kern der Botschaft ignorieren und religiöse Symbole als Stammeswappen missverstehen. Leider ist diese oberflächliche Form der Gläubigkeit weit verbreitet. Ich frage mich, was die Gläubigen denken, wenn sie die Checkpoints passieren und an der Mauer und den Flüchtlingslagern vorbeifahren.
Denken sie an die Evangelien? Denken sie daran, dass der Herr seinen Sohn gesandt hat, „um den Armen das Evangelium zu verkünden, den Gefangenen die Freiheit und den Blinden das Augenlicht zu bringen, die Unterdrückten in Freiheit zu setzen“ ? Was bedeutet der Besuch des Geburtsortes Jesu für sie? Wie halten sie es mit der Nachfolge Christi?
The Little Sisters of Jesus
Eine Asiatin mit einem Handystick schlüpft durch die Demutspforte, die Erste einer Gruppe asiatischer Christen. Die ehrfürchtigen fünf Minuten in der Geburtskirche sind vorbei. Erst nachher wird mir klar, was für ein Privileg es war, die Kirche so leer zu erleben. In einem normalen Jahr empfängt Bethlehem 1,5 Millionen Besucher. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs wirkt die Stadt wie ausgestorben.
Zu meiner Überraschung tritt Bassem, ein Bekannter von Tamir, auf uns zu und begrüßt uns. Er ist älter als Tamir, hat eine Halbglatze und trägt einen mächtigen Schnurrbart. Ich schätze ihn auf Mitte 50. Bassem spricht gutes Englisch und gibt uns eine Führung durch die Kirche. Er zeigt mir die verschiedenen, für die drei Religionen reservierten Bereiche und den Eingang zur Geburtsgrotte, in der zum Zeitpunkt unseres Besuchts eine Zeremonie stattfindet.
Anfangs ist mir nicht klar, was es mit seiner Anwesenheit auf sich hat, aber es dauert nicht lange, bis sich das Rätsel löst. Er lädt uns auf einen Kaffee in seinem Geschäft ein, das sich nur ein paar hundert Meter von der Geburtskirche entfernt befindet. Es kommen kaum Touristen nach Bethlehem, Tamir hat ihm offensichtlich Bescheid gesagt, in der Hoffnung, dass ich für Umsatz sorge.
Auf dem Weg zu seinem religiösen Souvenirladen kommen wir an einem Schild vorbei, das meine Aufmerksamkeit erregt: „The Little Sisters of Jesus“. Ich mache ein Foto des Schildes, in der Annahme, dass es sich um einen originellen Namen für ein Geschäft handelt. Ich war der Ansicht gewesen, dass Jesus auf Grund der göttlichen Vaterschaft ein Einzelkind gewesen sei. (Zurück im Hotel gebe ich den Namen bei Google ein und es stellt sich heraus, dass es sich bei den „Little Sisters“ um ein katholische Ordensgemeinschaft handelt, die sich nicht auf Jesus Christus, sondern auf den französischen Mönch und Eremiten Charles de Jésus beruft).
Keine Pilger im Heiligen Land
Im Laden angekommen besteht Bassem darauf, dass wir erst einmal gemeinsam den versprochenen Kaffee trinken. An den Wänden seines Geschäfts stehen Regale aus dunkel gebeiztem Holz. Auf einem stehen in Reihen und nach Größe geordnet Olivenholzschnitzereien: Kreuze, Krippen und Heiligenstatuen. Aber es sind die orthodoxen Ikonen, die den Raum dominieren. Ihre Ästhetik erinnert mich an die Figuren der Kapelle meines Hotels. Ihre mit Blattgold verzierten Oberflächen reflektieren das Licht, während die gemalten Figuren den Betrachter aus ihren länglichen, ernsten Gesichtern anstarren.
Bassem bringt den Kaffee. Wir setzen uns auf eine Bank vor dem Geschäft und unterhalten uns über die schwierige Situation, in der sich die palästinensischen Christen in Bethlehem befinden. Viele von ihnen leben wie er vom Tourismus aber seit dem siebten Oktober und dem Beginn der israelischen Vergeltungskampagne kommen kaum noch Touristen nach Bethlehem. Das Geburtsland des palästinensischen Juden Jesus von Nazareth war einmal die Heimat einer großen christlichen Gemeinschaft.
Laut Informationen der UN lebten im Dezember 1946 145.000 Christen im Land, was 12 % der gesamten palästinensisch-arabischen Bevölkerung entsprach. Während der „Nakba“ von 1948 wurden 75.000 palästinensische Christen aus ihren Häusern vertrieben und zu Flüchtlingen in den Nachbarländern sowie im Westjordanland und im Gazastreifen. Heute leben im Westjordanland etwa 45.000 Christen, während es in Gaza nur noch etwa 1000 sind.
Die palästinensischen Christen stellen seit jeher ein Problem für das zionistische Propagandanarrativ von den antisemitischen Islamofaschisten dar, denn auch palästinensische Christen haben sich in vorderster Front am bewaffneten Widerstand gegen das zionistische Kolonialprojekt beteiligt. Besonders prominente Beispiele für militanten Widerstand aus der christlichen Bevölkerung Palästinas sind George Habash und Wadie Haddad. Beide Männer wurden als griechisch-orthodoxe Christen geboren und aus ihrer Heimat vertrieben.
Vom Arzt zum Terroristen
Sie lernten sich während des Medizinstudiums in Beirut kennen und arbeiteten anfangs als Ärzte in den damals gerade entstandenen Flüchtlingslagern. Danach begannen sie sich im Widerstand zu engagieren und gründeten in den späten sechziger Jahren des letzten Jahrtausends die heute noch existierende marxistisch-leninistische Gruppierung „Popular Front for the Liberation of Palestine“ (PFLP), die „Volksfront für die Befreiung Palästinas“.
Der Werdegang der beiden Männer macht deutlich, wie nebensächlich ideologische und religiöse Label für die tatsächliche Motivation der Akteure sind. Habash und Haddad waren weder vom christlichen Glauben noch vom revolutionären Marxismus motiviert, so wenig wie heute die Kämpfer der „al Qassam“ Brigaden vom Islam motiviert sind.
Was also hat aus Habash, dem christlichen Arzt, einen gewaltbereiten Revolutionär gemacht? Ein Journalist für das damals noch relevante und keiner Sympathie für den palästinensischen Widerstand verdächtige „Time“ Magazin hat dem 2008 verstorbenen Habash einmal genau diese Frage gestellt. Die Schilderung des „Time“ Journalisten Scott MacLeod ist erhellend. Auf MacLeods Frage nach seiner Motivation erzählte ihm Habash einfach von seinen persönlichen Erfahrungen, als seine Familie während des Krieges 1948 ihr Zuhause verlor:
„Seine Mutter bestand darauf, dass er für sein Studium im Libanon blieb. Als der Krieg 1948 ausbrach, kehrte er nach Lydda zurück. Im Juli marschierten israelische Truppen unter der Führung von Moshe Dayan in Lydda ein. In israelischen Berichten wurden die Palästinenser lange Zeit als „geflohen“ dargestellt. Der israelische Historiker Benny Morris schrieb jedoch 1999, dass israelische Streitkräfte mindestens 250 Stadtbewohner getötet hätten, darunter junge Männer, die in einer Moschee massakriert wurden.
Keine Zeit mehr für Gott
Es war der Schrecken, an den sich auch Habash erinnerte und der durch eine persönliche Tragödie noch verschlimmert wurde: In derselben Nacht starb eine seiner Schwestern. Obwohl sie an Typhus starb, machte der Clan den israelischen Angriff dafür verantwortlich, dass sie nicht angemessen versorgt werden konnte. Er begrub seine Schwester im Hinterhof, nahm ihre kleinen Kinder an die Hand und folgte den Anweisungen der israelischen Soldaten, die Stadt zu verlassen. „Die Soldaten sagten: ‚Alle raus! In diese Richtung!‘ Ich weiß noch, dass ich einen der Soldaten fragte, wohin wir gehen sollten.“ Habash erzählte mir, dass er damals das Christentum ablehnte. “Ich stellte mir die ganze Zeit vor, wie ich als guter Christ den Armen diente. Als mein Land besetzt wurde, hatte ich keine Zeit, über Religion nachzudenken.“
Habash kehrte nie nach Lydda zurück, das in Lod umbenannt wurde und Teil des Staates Israel wurde.“⁴⁹
Es war offensichtlich nicht nötig, Habash den Hass auf die Israelis zu lehren und er hat nicht zu den Waffen gegriffen, weil er Marx und Lenin gelesen hat. Wie viele der tausenden jungen Palästinenser, die gerade in Gaza ähnliche Erfahrungen machen, werden sich für den bewaffneten Kampf entscheiden?
Die „PFLP“ leistete Pionierarbeit bei der Entführung von Flugzeugen als Terrortaktik im Nahen Osten zwar bereits 1968, als drei bewaffnete PFLP-Agenten ein israelisches El-Al-Flugzeug auf dem Weg von Rom nach Tel Aviv kaperten. Seitdem ist das Einchecken für einen Flug nicht mehr dasselbe.
Im Gegensatz zur „Hamas“ war die „PFLP“ zum damaligen Zeitpunkt tatsächliche eine global operierende Gruppe, die sich terroristischer Mittel bedient hat, um ihre politischen Ziele zu erreichen. 1970 entführten „PFLP“ Mitglieder vier Flugzeuge gleichzeitig, flogen drei davon nach Jordanien, sprengten sie in die Luft und lösten damit einen Krieg zwischen der jordanischen Monarchie und den palästinensischen Guerillas aus.
In Deutschland ist vor allem die Entführung des Lufthansafluges „Landshut“, durch die „PLFP-SC“, eine Abspaltung der von Habash und Haddad gegründeten Gruppe, in Erinnerung geblieben. Die Entführer forderten die Freilassung von elf in der Bundesrepublik inhaftierten Terroristen der ersten Generation der „RAF“, darunter Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe und Irmgard Möller.
PLFP meets RAF
Darüber hinaus wollte das Kommando zwei in türkischen Gefängnissen einsitzende Palästinenser freipressen, als Lösegeld verlangten die Entführer außerdem 15 Millionen US-Dollar. Das fünftägige Drama endete im Oktober 1977 mit der Stürmung der Maschine in Mogadischu durch eine Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei, der berühmten GSG-9. Die gescheiterte Operation war vermutlich der Auslöser für die Selbstmorde der „RAF“ Führungsfiguren im Stammheimer Gefängnis.
In einem Papier des „INSS“, dem „Institute for National Security Studies“, einem „think tank“ der Universität von Tel Aviv, wird Haddad mit folgender Beschreibung der Strategie der „PFLP“ zitiert:
“Ich meine spektakuläre, einmalige Aktionen. Diese spektakulären Operationen werden die Aufmerksamkeit der Welt auf das Problem Palästina lenken. Die Welt wird sich fragen: „Was zum Teufel ist das Problem in Palästina? Wer sind diese Palästinenser? Warum tun sie diese Dinge? Gleichzeitig werden solche Operationen für die Israelis sehr schmerzhaft sein. Aufsehenerregende, sensationelle Operationen, durchgeführt von gut ausgebildeten Leuten in sicheren geheimen Strukturen – so werden wir sie an den schmerzhaften Stellen treffen. Am Ende wird die Welt die Nase voll haben von ihrem Problem; sie wird beschließen, dass sie etwas für Palästina tun muss. Sie wird uns Gerechtigkeit widerfahren lassen müssen.“⁵⁰
Bisher hat die Welt den Palästinensern noch keine Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wadie Haddad starb 1978 unter entsetzlichen Schmerzen in einem Ost-Berliner Krankenhaus. Allem Anschein nach ermordete ihn der israelische Geheimdienst „Mossad“ mit vergifteter Zahnpasta. ⁵¹
George Habash starb 2008 in der jordanischen Stadt Amman an einer Herzattacke. As’ad AbuKhalil , Professor für Politikwissenschaft an der California State University, beschrieb seine Reaktion auf die Nachricht in einem Artikel für den Blog des „International Solidarity Movement“ :
„Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens in den USA verbracht und nie das Gefühl der Entfremdung verspürt, das ich an dem Tag empfand, als ich in einem Nachruf auf der Titelseite der New York Times las, dass George Habash, der palästinensische Revolutionär, der letzte Woche verstorben ist, als „Terrorismus-Taktiker“ bezeichnet wurde. Was tun Sie, wenn man Sie davon überzeugen will, dass ein freundlicher und sanfter Mann, den Sie als Person kennengelernt und respektiert haben, ein Terrorist ist, obwohl Sie es besser wissen? Streiten Sie vergeblich über Definitionen?
Gehen Sie zurück und sehen Sie, wie die „Times“ glühende Nachrufe für den zionistischen Milizenführer und späteren israelischen Premierminister Yitzhak Rabin geschrieben hat, einen Mann, dessen Bilanz bei der Tötung von Zivilisten genauso schrecklich und grotesk ist wie die von Osama Bin Laden, dem ehemaligen israelischen Premierminister Menachem Begin, dem Gründer des Fatah-Revolutionsrats Abu Nidal oder dem chilenischen Diktator Augusto Pinochet?“52
Habash und Haddad sahen im bewaffneten Kampf die einzige Möglichkeit, ihre politischen Ziele zu erreichen; eine Sichtweise, die sie mit Yitzhak Rabin, Menachem Begin und David Ben-Gurion teilten. Daneben existiert aber auch eine lange Tradition gewaltlosen palästinensischen Widerstands. Die letzte große Welle gewaltlosen Widerstands waren die „Great Marches of Return“- Demonstrationen.
Die „Great Marches of Return“ begannen am 30. März 2018, um das Ende der israelischen Blockade und das Rückkehrrecht für Flüchtlinge der „Nakba“ und ihre Nachkommen zu fordern. Die „IDF“ reagierte auf die zum Großteil friedlichen Demonstration mit extremer Gewalt und gezielten Tötungen durch Scharfschützen. Unter den Getöteten waren Kinder, Rettungssanitäter, Journalisten und Menschen mit Behinderungen. 183 Menschen wurden erschossen und weitere 6.106 mit scharfer Munition verwundet.⁵³
Munther Isaac, der Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Betlehem, ist ein aktuelles Beispiel für diese Tradition des gewaltlosen palästinensischen Widerstands. Am 18.2.2024, fünf Tage vor meiner Ankunft in Israel, hielt Isaac eine Predigt in der „Bloomsbury Central Church“ in England.
Der Verrat der Glaubensbrüder
Er appellierte an das Gewissen seiner christlichen Glaubensbrüder und beschrieb die Situation in Palästina mit deutlichen Worten: „Ich wende mich an die Kirchen im Vereinigten Königreich: Als Kirchen, die nach Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit streben, müssen wir im Gehorsam gegenüber dem Gebot Christi den Mut haben, unsere Meinung zu sagen und die Dinge beim Namen zu nennen! Dies ist kein Konflikt; Israel übt nicht sein Recht auf Selbstverteidigung aus. Vielmehr ist Israel der Kolonisator; Israel ist eine Siedlerkolonie. Wir leben unter Apartheid. Was in Gaza geschieht, ist ein Völkermord und eine ethnische Säuberung.“⁵⁴
Isaacs Kritik an der fehlenden Unterstützung der palästinensischen Sache durch westliche Christen, vor allem Christen in den USA, scheint gerechtfertigt. Die von dem amerikanischen Teleevangelisten John Hagee gegründete Organisation „CUFI“, „Christians United For Israel“, beispielsweise, hat nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Mitglieder. „CUFI“ unterstützt die illegale Besiedlung des Westjordanlands und ignoriert die Situation der Christen dort. Hagee und „CUFI“ sind fanatische Unterstützer Israels, dessen Existenz sie als Erfüllung der biblischen Prophezeiung sehen und als Zeichen für die baldige Wiederkehr des Heilands.⁵⁵
Die „Christian Zionists“ unterstützen die Annektion Westjordanlands und einen rein jüdischen Staat, weil nur so die Prophezeiung in Erfüllung gehen kann. Die Rückkehr des Heilands wäre allerdings keine gute Nachricht für die Juden, die es wagen würden weiterhin auf ihrem Judentum zu bestehen, wie sie es in der Mehrheit schon beim ersten Besuch des Heilands auf Erden getan haben. Es herrscht Uneinigkeit unter den Evangelikalen, was genau mit diesen verstockten Juden geschehen würde, aber Konsens scheint zu sein, dass über sie gerichtet würde und der Himmel ihnen verwehrt bleibt. Wenn es im Islam eine ähnliche Prophezeiung gäbe, würde man sie sicher als antisemitisch bezeichnen.
Die „Christian Zionists“ sind mittlerweile die wichtigsten und unkritischsten Unterstützer der israelischen Regierung. Ihre Zahl wird allein in den USA auf 30 Millionen geschätzt, sie sind gut organisiert und verfügen über große politische Macht. Netanjahu spricht auf ihren Konferenzen und beschwört ihren Bund mit Israel. Die Situation ist an Absurdität kaum zu überbieten: Während ultraorthodoxe Juden wie Yaakov Shapiro die israelischen Zionisten ablehnen, sie des Identitätsdiebstahls bezichtigen und sich dagegen wehren mit Israel identifiziert werden, lässt sich die atheistische zionistische Elite um Netanjahu auf ein Bündnis mit diesen ignoranten Fanatikern ein – mit Fanatikern, die einer antisemitischen Ideologie anhängen.
Heilige Erde für die Schwiegermutter
Diese Art von absurden Verstrickungen und Inkonsistenzen sind mit ein Grund dafür, warum mir jede Form organisierter Religion und Ideologie suspekt sind. Aber Bassem und sein Souvenirgeschäft haben nichts mit dem Missbrauch christlicher Ideen zu tun, er will seine Familie ernähren und ich bin offensichtlich seit Tagen der erste Kunde in seinem Geschäft.
Ich weiß, dass meine Schwiegermutter sich über christliche Mitbringsel direkt aus Bethlehem freuen wird und lasse mich auf das Verkaufsgespräch ein. Er zeigt mir eine kleine Ikone mit Blattgoldrand. Der Preis, den er mir dafür nennt, erscheint mir viel zu hoch und wir fangen an zu handeln.
Am Ende kaufe ich die Ikone, ein größeres Kreuz und ein kleines, das in einem transparenten Beutel mit zertifiziert heiliger Erde aus Bethlehem verpackt ist. Als kostenlosen Bonus legt Bassem noch eine Kette mit einem Davidsternanhänger drauf. Als wir wieder im Auto sitzen, lobt mich Tamir dafür, dass ich gehandelt habe. Er sagt, er wäre eingeschritten, wenn ich den ersten Preis akzeptiert hätte. Als wir den „Tunnels“ Checkpoint erreichen, erhalte ich einen kleinen Eindruck davon, wie Palästinenser die Begegnungen mit israelischen Soldaten erleben.
Der auf der Fahrbahn stehende Soldat bedeutet uns auf der Nebenspur anzuhalten. Als wir zum Stehen kommen, klopft er mit dem Lauf seiner M1G an das Fenster der Fahrertür. Tamir lässt das Fenster herunter und der Soldat spricht ihn auf Hebräisch an. In dem Auftreten des jungen Soldaten ist nichts von der oberflächlichen, mechanischen Höflichkeit, die ich von Grenzbeamten gewohnt bin. Sein Ton ist herablassend, er dominiert die Situation auf eine lässige, unterschwellig bedrohliche Weise.
Tamir antwortete ihm auf Hebräisch. Ich sitze auf der Rückbank, der Soldat wendet mir seine Aufmerksamkeit zu, offensichtlich hat Tamir ihm erklärt, was der Anlass für die Tour war. Der Soldat fordert mich auf, ihm meinen Pass zu zeigen und studiert die Besucherkarte, die ich am Flughafen erhalten habe. Danach lässt er uns weiterfahren. Ich frage Tamir, was das „worse case scenario“ einer solchen Begegnung am Checkpoint wäre.
Strikter Sabbat in Jerusalem
„They can arrest you. And they can keep you as long as they like“, antwortet er ohne zu zögern. “They have a special name for it, I don’t know what it is called in English”. (Später finde ich heraus, dass er “administrative detention” meint, “Verwaltungshaft“: „Bei der Verwaltungshaft wird eine Person ohne Gerichtsverfahren festgehalten, ohne eine Straftat begangen zu haben, mit der Begründung, dass sie in Zukunft gegen das Gesetz verstoßen will. Da diese Maßnahme präventiv sein soll, ist sie zeitlich nicht begrenzt.“) ⁵⁶
Ich wechsle das Thema und erzähle Tamir, dass ich am Abend zuvor Schwierigkeiten hatte, ein offenes Restaurant zu finden.
Er antwortet, dass das am nächsten Tag noch schwieriger werden würde, denn in Jerusalem werde der Sabbat im Gegensatz zu Tel Aviv strikt eingehalten. Die meisten Geschäfte und Restaurants schließen schon Freitagnachmittag. Daran hatte ich nicht gedacht und frage ihn, ob es überhaupt möglich sei, am Samstag einen Zug nach Tel Aviv zu bekommen. „No, I don’t think so“, antwortet er.
Ich spüre Nervosität in mir aufsteigen. Mein Rückflug von Tel Aviv nach Amsterdam geht Sonntag sehr früh morgens, ich hatte die letzte Nacht in Tel Aviv verbringen wollen. Auch die Vorstellung, dass am nächsten Tag in Jerusalem alles geschlossen haben wird, gefällt mir nicht. Bevor mich Tamir beim Hotel absetzt, einige ich mich ihm darauf, dass ich mich später bei ihm melde, falls ich mich entscheide, Jerusalem noch an diesem Tag zu verlassen.
Die Aufhebung der Grünen Linie
Zurück im Hotel beantworte ich E-Mails und suche nach weiteren Informationen zu den Checkpoints. Zu meiner Überraschung finde ich einen wissenschaftlichen Artikel von 2021, der sich explizit mit dem „Tunnels“ Checkpoint befasst. Der 25 seitige Artikel, verfasst von einer niederländischen Geografin, kommt zu folgendem Schluss:
„Die Willkür bei der Entscheidung, wer angehalten wird und wer nicht – was für meine Interviewpartner auch die Kontrolle von Pendlern beinhaltete, die täglich diese Checkpoints passieren – zeigt, dass die Checkpoints ein Instrument für israelische Soldaten sind, um die asymmetrischen Beziehungen zwischen Besatzer und Besetzten zu verstärken.
Als solche erzeugen die Checkpoints durch ihre räumliche Gestaltung, ihr Design und ihre Manager spezifische Geografien, die auf die Einschränkung und Kontrolle der Bewegungsfreiheit der Palästinenser abzielen, während sie gleichzeitig die fortgesetzte Aufhebung der „Grünen Linie“ und die zukünftige Errichtung eines „Groß-Israels“ vorantreiben.“⁵⁷
Ich bin mir nach wie vor unsicher, ob ich wie geplant noch eine Nacht in Jerusalem verbringen soll oder nicht. Tamir hatte Recht, am Samstag fahren die Züge in Israel nicht. Mittlerweile ist es 13 Uhr, der letzte Zug fährt nach Tel Aviv fährt in zwei Stunden. Die Altstadt und die Klagemauer haben mich am meisten beeindruckt und ich möchte ihnen noch einen, vielleicht den letzten, Besuch abstatten.
Als ich aus der schmalen Gasse heraustrete, an deren Ende das Hotel hinter einer Mauer verborgen liegt, bietet sich mir ein Bild, das sich stark von den Tagen zuvor unterscheidet. Die Straße ist voller Menschen, viele Palästinenser in kleinen Gruppen, die offensichtlich zum Damaskustor wollen.
Es ist die Zeit des Freitagsgebets, sie sind auf dem Weg zur al-Aqsa-Moschee. An den Tagen zuvor stand nur eine kleine Gruppe israelischer Soldaten an den befestigten Wachhäusern am Damaskustor. An diesem Tag sind es viel mehr und sie stehen schon weit vor dem Tor auf der Straße.
Das Privileg ignoriert zu werden
Die Soldaten operieren mehrere „flying checkpoints“, picken sich willkürlich Passanten heraus und wollen die Papiere sehen. Wenn die Überprüfung eines Einzelnen länger dauert, befehlen sie den anderen weiterzugehen. Ihre Behandlung der Palästinenser ist respektlos und aggressiv, sie versuchen gar nicht ihre Verachtung zu verbergen. Mich ignorieren sie vollständig, nie zuvor ist mir das Privileg meiner weißen Hautfarbe so deutlich bewusst geworden.
Am Wachhaus vor dem Damaskustor steht heute auch eine größere Anzahl von Soldaten, die mich ebenfalls ignorieren. Auch in der Altstadt ist heute alles anders: Die Soldaten stehen nicht wie an den Tagen zuvor hinter seitlich stehenden Metallabsperrungen. Heute stehen die Metallabsperrungen mitten in der Gasse, sind zu weiteren „flying checkpoints“ geworden.
Auch wenn ich bisher kein einziges Mal nach meinen Papieren gefragt wurde, fällt mir ein, dass ich meinen Pass im Hotel gelassen habe. Die enge Gasse ist jetzt voller Menschen, ich komme nur langsam voran. Mir wird klar, dass ich den Zug verpassen werde, wenn ich weitergehe.
Ich entscheide mich, Jerusalem zu verlassen und kehre um. Wieder in der Nähe des Hotels angekommen, bleibe ich noch einige Minuten auf der Straße stehen und beobachte die Interaktionen an den „flying checkpoints.“ Die Überheblichkeit der Soldaten kommt lässig daher, aber das macht sie noch provokativer und bedrohlicher.
Es ist offensichtlich, dass die Stimmung jederzeit kippen kann. Die Dehumanisierung der Palästinenser, die sich im Verhalten der Soldaten ausdrückt, ist so offensichtlich und eindeutig; ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Kaum einer der Palästinenser wagt es, sich zu echauffieren, zu diskutieren, sie wissen genau, welche Konsequenzen ihnen drohen.
Flucht aus Jerusalem
Im Zimmer angekommen, schreibe ich Tamir eine Nachricht. Ich bitte ihn, mich abzuholen und beginne meinen abgewetzten roten Kabinentrolley zu packen. Tamir reagiert schnell, hat aber keine Zeit und verspricht mir einen Freund zu schicken, um mich abzuholen. Mohamed sei in spätestens einer halben Stunde da, ausreichend Zeit, um den letzten Zug Richtung Tel Aviv zu erreichen.
Ich nutze die Wartezeit, um online zwei Nächte in einem Hotel in Tel Aviv zu buchen und der freundlichen Rezeptionistin mit der blauen Hornbrille zu erklären, warum ich das Hotel schon eine Nacht früher verlasse. Ich will nicht, dass sie denkt, dass etwas mit dem Zimmer nicht in Ordnung gewesen sei.
Kaum habe ich sie von meiner Unwissenheit über die strikte Einhaltung des Sabbats in Jerusalem und meiner mangelhaften Planung überzeugt, erhalte ich eine Nachricht von Mohamed. Er wartet am Eingang der Gasse auf mich. Ich verabschiede mich und mache mich auf den Weg zu ihm. Mohamed ist älter als Tamir, wirkt nüchterner, weniger modisch.
Seine Haare sind kurzgeschoren und er trägt ein schlichtes schwarzes Hemd. Er spricht gutes Englisch und erzählt mir, dass er Ingenieurwissenschaften studiere, aber im Moment aussetzen würde, um mit dem Taxifahren Geld zu verdienen und seine Familie zu unterstützen.
Ich erzähle ihm von der Szene auf der Straße. Mohamed ist unbeeindruckt. Das sei gar nichts, er kenne viele, die bei solchen Kontrollen verhaftet worden und für lange Zeit verschwunden seien. Seit dem siebten Oktober sei alles nur noch extremer geworden. Ich erinnere mich noch genau an meine Reaktion, weil sie mir im Nachhinein so unangenehm ist.
Ich frage ihn: „What can you do in such a situation? Just accept it?” “No, I don’t accept it“, antwortet er, sein Ton bleibt ruhig, aber ich spüre den Schmerz und den Zorn, den er verbirgt.
Was für eine dumme Frage. Wie würde ich mich in seiner Situation fühlen? Als Mensch zweiter Klasse? Würde ich es einfach akzeptieren? Ich entschuldige mich für meine dumme Frage und dann sind wir auch schon am Bahnhof angekommen. Er sieht mich an und verabschiedet sich lächelnd: „Don’t worry. It’s hard to imagine for someone who doesn’t live here. I understand. Have a safe trip.”
„We’re fucking them“
Der letzte Zug nach Tel Aviv steht schon am Gleis, wird aber erst in 15 Minuten abfahren. Nachdem ich das Ticket am Automaten gekauft und meinen Trolley im Zug deponiert habe, fällt mir ein Grüppchen von drei Soldaten auf, die halb versteckt hinter einer Säule Zigaretten rauchen. Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit, mit israelischen Soldaten ins Gespräch zu kommen. Das scheint eine gute Gelegenheit zu sein.
Ich steige wieder aus dem Waggon aus und gehe zu ihnen. Sie sind jung, Wehrdienstleistende, eine Frau und zwei Männer. Ich hole eine Zigarette heraus und bitte um Feuer. Als ich meine Zigarette angezündet habe, bedeuten sie mir näher zu kommen, mich wie sie hinter die Säule zu stellen, Rauchen auf dem Gleis sei verboten. Der Wortführer, korpulent und mit Dreitagebart, fragt, woher ich komme und ich antworte wahrheitsgemäß. Die junge Frau will wissen, ob es in Deutschland auch eine Wehrpflicht gäbe. Als ich das verneine, erklärt sie mir das israelische System.
Plötzlich fragt mich der Korpulente, was ich über den Krieg in Gaza denke. Damit habe ich nicht gerechnet und mir fällt nichts Besseres ein als zu sagen: „Well, it’s not a fair fight, is it?“ Der Dritte, ein schlaksiger Brillenträger, der bisher geschwiegen hat, sieht mich nachdenklich an und antwortet: „No, it isn’t.“ Der Korpulente nimmt die Fäuste an die Seite, stößt das Becken nach vorne und sagt:“We’re fucking them.“